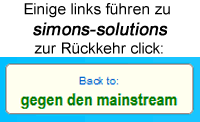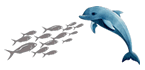Zugriff nicht gestattet. Bitte geben Sie zuerst Ihr Kennwort ein. Sie haben kein Kennwort und möchten diesen geschützten Beitrag lesen? Melden Sie sich bitte beim Seitenbetreiber.
Old simon ….

.. ein alter, weißer, heterosexueller,
cis Mann, der nicht zornig ist , sondern traurig.
1968 träumten wir von einer Welt, in der es verboten ist zu verbieten.
Die neue Generation denkt nur daran, zu zensieren, was sie kränkt oder ‚beleidigt‘.
Wofür gingen wir damals auf die Straße?
Ing. Dkfm. Peter Simon
cis Mann, der nicht zornig ist , sondern traurig.
1968 träumten wir von einer Welt, in der es verboten ist zu verbieten.
Die neue Generation denkt nur daran, zu zensieren, was sie kränkt oder ‚beleidigt‘.
Wofür gingen wir damals auf die Straße?
Ing. Dkfm. Peter Simon